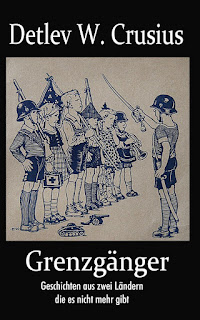Band 6 der Familiensaga
Band 6 der Familiensaga
Berlin 1943. Während das Siegesgeschrei der faschistischen Machthaber immer lauter wird, verstärken die Alliierten massiv die Bombenangriffe auf die deutschen Städte. Die Front im Osten bricht mehr und mehr zusammen. Elsie arbeitet in Berlin bei der Polizei als Protokollantin, und sie erlebt die brutalen Verhörmethoden der Gestapo.
Ihr Vater ist im Widerstand aktiv. Er wird verraten und stirbt im KZ Dachau. Elsie sieht für sich keine Zukunft in Deutschland und sie beschließt, ihre Heimat zu verlassen.
Mit gefälschten Papieren macht sie sich auf den gefährlichen Weg durch Frankreich, Spanien bis Lissabon, wo sie auf eine Schiffspassage nach Mexiko hofft.
Auf ihrem langen Weg in die Freiheit erlebt sie Hass,
Not, Verzweiflung - und Liebe.
Books Amazon zur Serie Leseprobe
Donnerstag, 19. Dezember 2024
1943 - Transit nach Mexiko
Freitag, 5. Juli 2024
Die Grenze - Anne in Ostberlin
Mai 1945, der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Die deutschen Städte sind zerstört, die Menschen hungern, die Familien sind zerrissen. Anne lebt mit Richard in Berlin Spandau. Hilde, eine Freundin aus Kriegszeiten, verschafft ihr eine Anstellung im Polizeipräsidium und sie erleben die Prozesse gegen NS-Verbrecher.
Das Leben in der DDR wird immer karger, das Plansoll der Betriebe wird drastisch erhöht. Am 17. Juni 1953 kommt es zu Aufständen. Anne ist zu Besuch bei ihren Eltern in Güstrow, sie kann nicht zurück nach Westberlin, die Grenzen sind abgeriegelt. Ein Freund ihres Vaters bringt sie illegal an allen Kontrollen vorbei bis zur Sektorengrenze und sie überquert die Grenze nach Westberlin.
Trotz des Schießbefehls fliehen immer mehr Menschen in den Westen. Am 13. August 1961 beginnt man in Ostberlin mit dem Bau der Mauer, die viele Jahre das Leben in Deutschland bestimmen wird.
Mittwoch, 3. Juli 2024
Grenzjahre
Band 1 der Familiensaga
1941 - Landsberg a.d. Warthe, eine kleine Stadt nahe Pommern. Der Zweite Weltkrieg tobt an allen Fronten, aber die Mehrheit der Deutschen glaubt der Propaganda und zweifelt nicht am Endsieg.
Als in den folgenden Jahren ein Frontabschnitt nach dem anderen zusammenbricht und Mitte 1944 aus Ostpreußen der Strom der Flüchtlinge nach Westen einsetzt, verlässt auch Walthers Familie die Heimat. Nach vielen Stationen in Flüchtlingslagern erreichen sie Jahre später Güstrow, und sie glauben, eine neue Heimat gefunden zu haben.
Als der Druck der SED unerträglich wird, beschließen sie, die DDR zu verlassen. Ein Vorhaben, das in die Freiheit führen kann oder in das berüchtigte Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen.
Eine Familiensaga vor dem Hintergrund der NS-Zeit, des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Teilung.
Books Amazon Leseprobe Link zur Serie
Mittwoch, 27. September 2023
Grenzwall - Anne in Berlin
1941 - Anne lebt in der Kleinstadt Friedeberg in Pommern bei ihren Eltern. Bei einem Badeausflug lernt sie Wilhelm kennen. Sie verlieben sich und Anne folgt ihm gegen den Willen ihres Vaters nach Berlin. Was Anne nicht weiß - Wilhelm ist in der Waffen-SS und arbeitet für die Gestapo. Als Wilhelm herausfindet, dass Annes Vater jüdischer Abstammung ist, kommt es zu einem brutalen Zusammenstoß und Anne flieht zu ihrer Freundin Elsie.
Um zu überleben, tauchen sie ein in den kriminellen Untergrund Berlins der NS-Zeit.
1945 - der Krieg ist zu Ende. Annes Eltern und Geschwister konnten rechtzeitig aus Pommern fliehen und leben in der DDR in Güstrow. Anne beschafft sich eine Reisegenehmigung und reist von Westberlin nach Güstrow.
Freitag, 3. Juni 2022
Grenzland - der lange Weg nach Jerusalem
Band 2 der Familiensaga
1940 - Marlene und Hans Kupfer flüchten über die Ostsee nach Schweden. Sie sind Juden und ihr Ziel ist New York. Nach einem U-Boot-Angriff stranden sie auf den Azoren und werden dort zu Zwangsarbeit verpflichtet. Erst nach Jahren lässt man sie nach New York ausreisen.
Oskar, der Sohn von Marlene und Hans, hat seine große Liebe Lore kennengelernt und ist in Landsberg/Warthe geblieben. Lore ist Arierin und die Nürnberger Rassengesetze verbieten ihnen eine Hochzeit. Als sie den Druck der Nationalsozialisten nicht mehr ertragen, wollen sie Oskars Eltern folgen. Sie flüchten nach Schweden, aber der Krieg verhindert ihre Weiterreise.
1947 - In La Rochelle finden sie endlich zueinander. Aber der Krieg hat die Welt verändert und sie fühlen sich nirgendwo wirklich zu Hause. Da hören sie, dass im Nahen Osten ein neuer Staat gegründet werden soll. Gemeinsam wollen sie nach Jerusalem.
Samstag, 21. Mai 2022
Grenzgänger
Band 3 der FamiliensagaVor einigen Jahren fragte mich jemand, woher ich käme.
"Ich bin Deutscher", gab ich zur Antwort.
"Nein, das meine ich nicht. Aus welcher Stadt?"
Ich sagte: "Die Stadt gibt es nicht mehr, und das Land trägt jetzt einen anderen Namen. Später lebte ich ein paar Jahre in einem Land, das es auch nicht mehr gibt."
"Sie waren offenbar viel auf Reisen", sagte er.
"So könnte man sagen. Viel auf Reisen trifft es recht gut. Aber ich bin nichts Besonderes, auf Millionen Menschen traf das damals zu."
"Schreiben Sie das auf", sagte er.
Diese Geschichte ist meine Geschichte. Eine Geschichte von Flucht, Reisen, erneuter Flucht, von vielen Reisen. Und wissen Sie was? Ich will nicht eine Stunde, nicht eine Minute missen.
Freitag, 20. Mai 2022
Donnerstag, 19. Mai 2022
Saigon
Marseille 1955. Der Indochina-Krieg ist zu Ende, die Franzosen müssen sich geschlagen aus Saigon zurückziehen. Vor diesem Hintergrund lernen sich in Marseille zwei Männer kennen, die unterschiedlicher kaum sein können. Hans Larsson, deutscher Seemann, ist wegen einer Schlägerei im Knast gelandet und sein Schiff ist ohne ihn ausgelaufen. Jean-Pierre Laval ist ein deutscher Arzt mit zwielichtiger Vergangenheit bei der Waffen-SS. Gegen Ende des 2. Weltkrieges hatte er sich mit falschem Pass zur Fremdenlegion nach Vietnam abgesetzt. Was sie verbindet - beide suchen einen Weg, aus Europa zu verschwinden. Der Kapitän eines deutschen Frachtschiffes ist bereit, sie nach Saigon mitzunehmen und sie verlassen Marseille. Was nicht einmal der Kapitän weiß - im vorderen Laderaum des Schiffes stapeln sich bis unter die Lukendeckel Kisten mit Waffen. Ziel der heißen Fracht - Formosa.
Mittwoch, 18. Mai 2022
Ferne Ufer - Shanghai
Dienstag, 17. Mai 2022
Turkana - blutiges Afrika
Harry Kowalski, ehemaliger Bundeswehr-Soldat, ist nach zahlreichen
Afghanistan-Einsätzen als Frührentner nach Deutschland zurückkehrt.
Posttraumatisches Belastungssyndrom, PTBS, sagen die Ärzte.
Kowalskis
Sohn Sven ist nach Afrika geflohen. In Selbstjustiz hatte er den Mörder
seiner Frau gerichtet, nachdem dieser von der Justiz verschont blieb.
Inzwischen arbeitet er in Kenia im Grenzgebiet zum Südsudan als Arzt in
einem Flüchtlingslager und kämpft dort gegen Pocken, Gelbfieber und
Schlangenbisse.
Harry will seinen Sohn besuchen. Er reist nach Kenia und gerät in einen neuen Krieg. Eine
Bergbaugesellschaft vermutet Uranerz in dem Gebiet, wo sich das
Flüchtlingslager befindet. Sie heuern Söldner an, die unter den
Bewohnern des Flüchtlingslagers Angst und Schrecken verbreiten sollen.
Dabei stoßen sie auf unerwartete Gegenwehr, die der einstige
Afghanistan-Kämpfer Harry Kowalski organisiert.
Books Amazon Leseprobe Serie Afrika
Ebola - der Kongo - das schwarze Herz Afrikas
In einem Urwaldkrankenhaus am Ebola, einem Nebenfluss des Kongo, treffen drei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein können. Lars Petersen will illegal geschürfte Diamanten kaufen. Dr. Eduard Dupré kam vor vielen Jahren als Missionar und Arzt in den Kongo. Jetzt ist er nur noch Arzt, seinen Glauben hat er längst verloren. Und da ist seine viel zu junge Frau Zola, trotz ihres afrikanischen Vornamens gebürtige Belgierin. Eduard Dupré hat nicht nur mit Tropenkrankheiten zu kämpfen, sondern mit ausbleibenden Lieferungen der Hilfsorganisationen, gepanschten und längst verfallenen Medikamenten. Zur bitteren Erkenntnis, vielen Patienten nicht helfen zu können, kommen marodierende Regierungstruppen, Rebellen und Sklavenjäger aus dem Sudan. Da bricht erneut die Ebola-Seuche aus.
Kongo - Kinder der Savanne
Books Amazon Leseprobe Serie Afrika
Montag, 16. Mai 2022
Embargo
Sonntag, 15. Mai 2022
Zeiten ändern dich
Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit. Alexander, gerade aus dem Gefängnis entlassen, wird vom Verfassungsschutz erpresst. Gegen seinen Willen schleust man ihn in eine Nazi-Gruppierung ein. Sein Auftrag - er soll die Wahrheit herausfinden. Bald merkt er, dass er alles finden soll, nur nicht die Wahrheit. Auf dem gefahrvollen Weg durch das Nazi-Umfeld lernt er Lena kennen. Sie ist eine Hure, aber eine herzensgute Frau und sie verlieben sich ineinander.Books Amazon Leseprobe
Der lange Schatten der Lüge
Der Maulwurf aus Moskau
Martin arbeitet in der streng geheimen Entwicklungsabteilung der Air-Sliver in Wien, die in das lukrative Drohnen und Lenkwaffengeschäft einsteigen will. Sein richtiger Name ist Vladimir, er ist Russe und in Wahrheit arbeitet er für den russischen Geheimdienst.
Doch wer sind tatsächlich seine Auftraggeber? Immer tiefer gerät Martin alias Vladimir in einen gefährlichen Sog aus Spionage und Gegenspionage, und bald weiß er selbst nicht mehr, für wen er arbeitet.
Samstag, 14. Mai 2022
Kasino Rossija
Als Gesamtausgabe Taschenbuch u. eBook, oder 5 eBooks: Moskau - Monopoly - Zürich - Red Square - Irina.
Moskau 1985. In Moskau hat Gorbatschow die Macht übernommen und die Welt verändert sich. Robert ist Inhaber einer kleinen Softwarefirma in Westdeutschland. Scheinbar zufällig lernt er in Hannover Russen kennen, die ihn nach Moskau einladen. Software soll er liefern. Sehr bald erkennt er, dass die angeblichen Softwaregeschäfte nur als Vorwand dienen. Tatsächlich geht es um seine Beziehungen zu Schweizer Banken und den Treuhänder Urs Brükli in Zürich. Immer tiefer gerät er in den Sog der großen Ost - West Geschäfte in den Jahren des Zusammenbruchs der Sowjetunion.
Link zur Serie Kaasin Rossija
Donnerstag, 12. Mai 2022
Doppelspiel
November 1982 – mit Juri Wladimirowitsch Andropow steht ein Mann an der Spitze der Sowjetunion, der an Gefühlskälte alles in den Schatten stellt, was nach Stalin kam. Die Staaten des Warschauer Paktes rüsten auf und aus dem Kalten Krieg droht ein heißer zu werden. Windige Geschäftsleute haben frühzeitig erkannt, dass man nicht am Frieden, sondern am Kalten Krieg verdient. Arne Peters beliefert mit seinen Komplizen aus Ost und West die Sowjetunion und die DDR mit allem, was nach der Cocom-Liste verboten ist.
Die Stasi machte Arne Peters ein lukratives Angebot. Er soll etwas beschaffen, das sogar ihm als eiskaltem Profiteur des Kalten Krieges zu heiß ist – das von den Truppen des Warschauer Paktes heiß begehrte Feuerleitsystem des Leopard II der Bundeswehr. Als wäre das noch nicht Problem genug, kommt ihm eine attraktive Stasi-Agentin in die Quere.
Mittwoch, 11. Mai 2022
Montag, 9. Mai 2022
Der Plan
Libyen und der Nahe Osten - seit vielen Jahren ein Pulverfass.
Der
Journalist Eric Larsson recherchiert undercover in Tripolis. Er will
herausfinden, was tatsächlich hinter den streng geheimen libyschen
Waffenprogrammen steckt. Es geht um illegal nach Libyen gelangtes
Plutonium.
Wem kann er noch trauen? Da ist sein Freund Abdul, aber
ist er tatsächlich sein Freund? Oder Nicolas Debré, ein mit allen
Wassern gewaschener Geschäftemacher. Für wen arbeitet Nicolas in
Wahrheit? Und dann ist noch Laila im Spiel, eine verführerische
Palästinenserin.
zur Serie
Sonntag, 8. Mai 2022
Der Wert der Wahrheit
Jean Delong arbeitet für die SRA in Amman. Sein Job - er beschafft Informationen aus dem Hexenkessel Nahost. Der Treibstoff des Geschäfts ist Korruption bis in höchste Regierungskreise. Ihre wichtigste Quelle ist Sheikh Turki in Saudi Arabien. Jean Delong ist williger Akteur in diesem schmutzigen Spiel, bis er selbst nur knapp einem Anschlag entgeht, dem ein britischer Atomwissenschaftler zum Opfer fällt. Er taucht in Frankreich unter, aber seine Auftraggeber spüren ihn auf.Seine frustrierende Erkenntnis: Jobs dieser Art hängt man nicht einfach an den Nagel.
Freitag, 22. April 2022
Kaltgestellt
Das BKA hört mehrere Handygespräche zwischen Deutschland, Damaskus, Bagdad und Grosny ab. In den Gesprächen geht es um Terroranschläge in Westeuropa und um Drogen. In aller Eile installieren das BKA und der Verfassungsschutz in einem kleinen Ort am Niederrhein eine behelfsmäßige Kommandozentrale. Aus dieser Gegend kamen die Gespräche. Der Nahost Experte Walther Sembach, strafversetzt von Damaskus nach Deutschland, bekommt die undankbare Aufgabe, die Urheber der Telefonate zu ermitteln. Als er der Wahrheit zu nahe kommt, steht er selbst auf der Abschussliste.
Donnerstag, 31. März 2022
Tödliche Intrige
Ein anonymer Informant bietet dem schwedischen Journalisten Eric Larsson Informationen über die Hintergründe der Giftgasattacken in Damaskus an. Eric trifft die Quelle auf Malta – Judith, eine attraktive Israelin. Ihre gemeinsamen Nachforschungen führen sie über La Valetta, Zürich und Saudi-Arabien in den Hexenkessel Damaskus.Auf der langen und gefährlichen Reise fragt sich Eric immer häufiger – wer sind seine Auftraggeber in Wahrheit und wer ist Judith?
Donnerstag, 24. März 2022
Leben und Überleben
Geschichten aus dem Leben.
- Was eine junge Frau erlebt, die mit ihrem kleinen Sohn in Urlaub fahren will, aber nicht das Geld dafür hat.
- Die Betrüger, die das große Rad drehen wollen, und eine Bank über den Tisch ziehen.
- Wie lebt es sich im Knast und wie lebt es sich, wenn man rauskommt.
- Was alles passieren kann, wenn sich ein Seemann in eine Hure verliebt.
- Ost-Kongo. Eine Wanderung durch die Savanne, begleitet von hungrigen Raubtieren, angriffslustigen Elefanten und Wildhunden. Wie schmeckt geröstete Schlange?
- und noch einige Stories mehr ....
Mittwoch, 9. März 2022
Am Abgrund - Moskau 9. Mai
Jonny lernt im Gefängnis die Russin Larissa kennen. Sie hat ihren Zuhälter umgebracht. Jetzt hat sie ihre Haftstrafe verbüßt und soll nach Russland abgeschoben werden.
Jonny hat gemeinsam mit Russen in großem
Stil Banken betrogen. Auf ihn wartet eine lange Haftstrafe.
Da nimmt
der Prozess gegen Jonny einen unerwarteten Verlauf. Tschetschenische
Terroristen planen ein Attentat in Moskau während der Mai-Parade. Jonny
kennt einen der Attentäter. Die Staatsanwaltschaft macht ihm ein
verlockendes Angebot. Man will die Anklage fallen lassen, wenn er
behilflich ist, die Terroristen aus dem Verkehr zu ziehen. Zur Tarnung
soll Larissa als seine Ehefrau auftreten.
Donnerstag, 24. Februar 2022
Geliebte Mörderin - Schatten der Vergangenheit
Donnerstag, 3. Februar 2022
Inferno Damaskus
Syrien - ein Land kurz vor dem Auseinanderfall. Ulf Leitner hat viele Jahre von den Kriegsschauplätzen dieser Welt berichtet. Er sagt - Leichenberge kann man nur mit einem kräftigen Schluck Whisky aushalten. Mit den Leichenbergen wächst auch sein Alkoholkonsum. Erst kann ihn seine Frau Lydia nicht mehr ertragen und verlässt ihn. Dann erträgt der Chefredakteur seine ständigen Alkoholexzesse nicht mehr und wirft ihn raus.Ulf sitzt auf der Straße und hat nur ein Ziel - sich möglichst schnell mit Whisky unter die Erde zu bringen.
Lydia, Reporterin wie Ulf,
will aus Syrien über Steinigungen moslemischer Frauen in den besetzten
Gebieten berichten. Plötzlich bricht bricht der Kontakt zu Lydia ab. Ulf macht sich auf die Suche nach Lydia.
Montag, 31. Januar 2022
Mein russisches Tagebuch
Wie sind die Russen? Sie sind liebenswerte Überlebenskünstler.
Heiteres und Besinnliches aus Russland.
Donnerstag, 27. Januar 2022
Tarhuna - Giftgas für Libyen
Mittwoch, 26. Januar 2022
Die Akte Perm
Am 14. September 2008, dem Geburtstag des russischen Präsidenten Medwedew, stürzt in unmittelbarer Nähe der Stadt Perm am Ural ein Flugzeug der Aeroflot-Nord ab. Bereits am Tag nach dem Absturz ranken sich Gerüchte um das Unglück. Hat die Technik versagt, oder waren die Piloten betrunken und übermüdet? Oder hatten tschetschenische Terroristen die Boeing entführt und der Absturz war in Wahrheit ein gezielter Abschuss der russischen Luftwaffe?
Montag, 24. Januar 2022
Deckname Nikita
Moskau - Dezember 1990, wenige Wochen nach der Wiedervereinigung. Zufällig erfährt ein Mitarbeiter der Britischen Botschaft von einem geplanten Putsch gegen Gorbatschow. Einer der Putschisten ist Oleg Kirillowitsch. Doch wer ist Oleg? Ist er ein Steinzeit-Stalinist oder tschetschenischer Terrorist? Handelt er im Auftrag eines US-amerikanischen Geheimdienstes? Paul Bachmann, ehemaliger Mitarbeiter des BND, soll nach Moskau reisen und herausfinden, was die Putschisten planen.
Dienstag, 5. Mai 2020
Datenschutz
Datenschutz
Benachrichtigung bei Änderung der Datenschutzerklärung
Mail-Adresse
books@detlev-crusius.com
Artikel im Spiegel
Spanischer Bürgerkrieg -- Exodus der Kinder
Hitlers
Volkssturm -- Der letzte
Befehl
Seemannsbräuche
-- Einmal Neptun die Füße lecken
Flucht aus der DDR -- Neues Lager, neues Glück
Kindheit
in der Nachkriegszeit -- Als Thälmann-Pionier auf Du und Du mit
"Iwan"
Flucht
aus Pommern -- Die Brücke hinter uns ist in die Luft
geflogen!
Reise
mit der Transsib -- Ehe auf
Russisch
Bahnfahren, Bahnfahren, Bahnfahren! Seit Detlev Crusius mit seiner Frau durch Russland zur Verwandschaft reist, ist ihm klar: "In der Nähe" heißt in Russland etwas ganz anderes als in Deutschland.